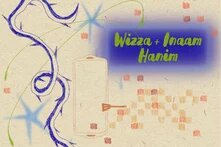Tunesien gilt als die Erfolgsgeschichte des „Arabischen Frühlings“, seit vor zehn Jahren der Langzeit-Diktator Ben Ali abgesetzt wurde. Doch im ersten Beitrag unserer Serie „Blick zurück nach vorn“ schreibt Rim Benrjeb über einen revolutionären Geist, der einzuschlafen droht, patriarchale und staatliche Gewalt sowie die Unmöglichkeit, all das mit dem eigenen Vater zu besprechen.

Es fällt mir nicht leicht, Vater, mit dir durch die Seiten der Vergangenheit zu blättern und jene Ereignisse durchzugehen, die Brandflecken auf meinem Herzen hinterlassen haben.
Zwölf Jahre ist es her, aber ich habe nie vergessen, wie du mich vor dem Gymnasium geschlagen hast, weil ich mit meinem Freund Hossam nach dem Angriff auf Gaza im Jahr 2009 eine Palästina-Demo organisiert hatte. Hunderte Schülerinnen und Schüler drängten sich durch die Straßen unseres abgelegenen Dorfes, skandierten Sprechgesänge, erst gegen die israelische Besatzung, dann, immer ergriffener und mutiger, gegen die tunesische Polizei und den Staatspräsidenten. Und ich führte die Demo an, übermütig, außer mir vor Stolz, Adrenalin war meine einzige Waffe. Über mögliche Konsequenzen, wie die Gefahr, vom Gymnasium zu fliegen oder ins Gefängnis zu kommen, dachte ich gar nicht nach.
Eine Woge aus Leidenschaft und Wut hatte unsere kleinen Körper erfasst. Immer lauter und lauter schrien unsere Stimmen nach Freiheit. Irgendwann beschloss eine Handvoll von uns, zum Ausgangspunkt zurück zu kehren, vor das Schulgebäude, um noch mehr Leute für den Marsch zu motivieren. Als ich vor einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern stand und ihnen erklärte, wie wichtig es sei, dass sie sich uns anschlossen, hatten die Polizeiwagen den Platz bereits umstellt. Ihre Drohungen und Schlagstöcke schüchterten uns nicht ein. Tapfer harrten wir aus vor dem Schulgebäude.
Damit, dass du plötzlich aus dem Pulk der Herbeistürmenden auftauchen würdest, hatte ich nicht gerechnet. Du gabst mir eine schallende Ohrfeige und beschimpftest mich. Du tratst nach mir und zerrissest meine blaue Schuluniform. Dass ich dabei keine einzige Träne vergoss, machte dich noch wütender. Du packtest mich an den Haaren, zerrtest mich zu Boden, schlugst mir auf Kopf und Bauch. Eine karnevaleske Szene, die die sadistische Eitelkeit der Polizisten zu befriedigen schien. Meinen Freundinnen und Freunden jedoch, die hilflos dabeistanden, blutete das Herz.
Es schaltete sich der Polizeidirektor ein, er bat dich, aufzuhören: „Es reicht, Rejeb. Sie wird's nicht wieder tun.“
Was ich dann sagte, hatte keiner von euch erwartet: „Ihr Hunde Ben Alis!“
Fassungslos schlugst du wieder und wieder zu, immer härtere Schläge prasselten auf mich nieder. Meine Gefühle dabei waren widersprüchlich. Da war einmal das Gefühl der Schmach, darüber, dass du mit diesem geifernden Hunderudel unter einer Decke stecktest, gleichzeitig war ich aber auch stolz: Ich, deine Tochter, hatte deinen wunden Punkt getroffen und dich in die direkte Konfrontation mit der Staatsmacht gezwungen. Und du hast für dich entschieden, mich zu schlagen, wohl um mir den Schulrauswurf und das Gefängnis zu ersparen, aber meine Würde hast du nicht geachtet.
Meine Würde, Vater, die von jenem Tag an begonnen hat, klare Formen anzunehmen und Sinn zu ergeben.
Immer wieder blickte ich auf mein Handy, das auf dem Bett lag. Ich nahm es in die Hand. Fokussierte all meine Kraft darauf, mich endlich aufzuraffen und dich anzurufen, tat es dann aber doch nicht. Mit einer Gruppe von Freundinnen und Freunden hatte ich beschlossen, einen Podcast zu produzieren, zum Thema Angst unter der Ben-Ali-Diktatur. „Selbst die Wände haben Ohren“ – das glaubten wir früher wirklich. Deshalb war für uns damals schon das bloße Reden über Politik hinter verschlossenen Türen ein Riesending gewesen. Aber die jüngere Generation, die die Diktatur nie miterlebt hat, kennt weder solche Gedanken, noch die Angst, mit der wir gelebt haben.
Und ich war verwirrt und auch ziemlich nervös, denn einer der Menschen, die ich für den Podcast interviewen wollte, warst du.
„Hallo? Na, Papa, wie geht's?“
„Hallo Liebes. Danke, gut. Wie geht's denn mit deinem Auto? Hast du immer noch Angst, damit zu fahren?“
„Die Straßen sind der reinste Horror. Die Menschen fahren wie die Verrückten.“
„Keine Angst. Fahr einfach ganz langsam und lass dich nicht hetzen.“
„Ich habe schon den Seitenspiegel zerdeppert. Ich glaube, ich bin einfach nicht der Typ fürs Autofahren.“
„Ach was, das ist Lehrgeld.“
Eigentlich ist es gar nicht meine Art, lange um den heißen Brei herum zu reden. Normalerweise komme ich immer recht schnell zur Sache. Aber plötzlich war mir so behaglich zumute beim Reden über Automechanik, Verkehrsregeln und Verkehrsschilder. Eine ganze Stunde verbrachten wir damit, über die Rolle der Verteilerkette im Automotor zu fachsimpeln. War sie nun aus Kunststoff oder doch aus Metall? Keiner von uns beiden hatte Ahnung von dieser komplexen Materie, trotzdem kriegten wir uns darüber in die Haare und gackerten wie die Hühner. Du erzähltest mir zum tausendsten Male von dem einzigen Auto, das du je besessen hast, damals, in den Siebzigern, als du ein berühmter Fußballspieler in El Kef warst. Es war ein Renault 17. Du sprachst von deinem Freund, dem Meister aller Automechaniker, ihrem geistigen Vater Herrn Fauzi, der ganze Generationen von Autos vor dem sicheren Tod gerettet und frisches Blut in ihre klapperigen Motoren gepumpt hat. Plötzlich fiel ich dir ins Wort.
„Sag mal, Papa – hattest du eigentlich Angst zu Ben Alis Zeiten?“
„Klar, wie jeder andere auch. Vor Spitzeln, besonders wenn ich in die Moschee beten ging. Und, wenn ich meine Mitgliedschaft bei der DMG erneuern musste.“
„Aber war es eher Angst oder Wut?“
„Ich weiß nicht. Beides wahrscheinlich. Ich wollte nie etwas mit der Partei zu tun haben. Aber meine Arbeit zwang mich dazu.“
Bevor mein Vater in Rente ging, war er Beamter bei der Distriktsverwaltung, der Moatamidiya gewesen, einer Abteilung des Innenministeriums, die die Belange des Distrikts regelt, in dem wir wohnten. Mein Vater arbeitete direkt mit dem Moatamid, dem Distriktsverwalter. Der wiederum stand unmittelbar unter der Aufsicht des Wali, des Regionalgouverneurs. Vor der Revolution unterteilte sich die tunesische Verwaltungsordnung in drei Grundebenen: Die Wilaya, sprich, die Provinz, mit dem Wali an der Spitze; die Moatamidiya, also der Distrikt, den der Moatamid verwaltet und die Amada, die Gemeinde, die vom Omda regiert wird, dem Bürgermeister. Über seinen Distrikt hatte der Moatamid uneingeschränkte Befugnisse, was unter anderem bedeutete, dass er sich in jede erdenkliche Sache einmischen konnte, ohne sich dafür erklären zu müssen – schließlich war er auf seinem Fleckchen Land direkter Vertreter der Staatsmacht und ihrer eisernen Faust! Ernannt wurde man für all diese Ämter rein anhand seiner Parteitreue, der Loyalität zur DMG – der Konstitutionellen Demokratischen Sammlung – ob man zudem auch administrative Kompetenzen vorzuweisen hatte, etwa für die Handhabung von Regierungsgeschäften, oder die Umsetzung der Entwicklungspolitik, war kein Kriterium.
An diesen Hierarchien ist die Revolution nicht spurlos vorüber gegangen. Die Lokalregierungen sind heute stärker geworden, und die Macht des Moatamid wird von gewählten Gemeinderäten in Schach gehalten. Der Moatamid allerdings wird auch heute noch anhand seiner Parteitreue ernannt und seine Befugnisse erheben nach wie vor ihn zum Herrscher über sein Volk.
Mein Vater war ein äußerst gewissenhafter Beamter. Sein ganzes Arbeitsleben hat er den Verlockungen von Bestechungsgeld, Geklüngel und Parteiintrigen widerstanden. All seine Energie und seinen Elan setzte er dafür ein, denjenigen Sozialhilfe zuzusichern, die sie wirklich brauchten. Und obwohl er gezwungen war, seine Mitgliedschaft regelmäßig zu erneuern, hasste er die Partei und ihre Repräsentanten im Dorf. Er hatte immer schon ein miserables Verhältnis zu ihnen gehabt, und sie versuchten alles, um ihn schlecht zu machen. In ihren Augen war er ein lästiger kleiner Rebell, den man am besten loswurde. Sie schrieben Berichte über ihn, in denen sie mal behaupteten, er sympathisiere mit den Islamisten, weil er zum Beten in die Moschee ging und Spinat und Petersilie bei einem Gemüsehändler kaufte, der unter Verdacht stand, der Nahda-Bewegung nahe zu stehen; dann behaupteten sie, er wäre ein verkappter Kommunist, weil er manchmal mit einem linken Geschichtsprofessor in einem Café Backgammon spielte.
Und so hatten sie am Tag der Schülerdemo ihre goldene Chance gewittert, meinen Vater endlich aus dem Verkehr zu ziehen. In heller Aufregung rannten sie zum Moatamid, um ihm brühwarm von dem Skandal zu berichten: „Rejebs Tochter führt Demos an und beleidigt das Regime!“ Aber leider hatte ich den Sohn des Chefs des Parteibüros auch überredet, mit uns mitzumarschieren. Er hatte uns sogar Parolen vorgerufen, die wir hinter ihm her skandierten. Diesen Umstand machte mein Vater sich später zunutze, um die Sache zu bereinigen. Und sie hatten keine andere Wahl, als die Anklage fallen zu lassen – schließlich hatte der „Goldjunge“ mit mir unter einer Decke gesteckt.
Aber, Vater: Du warst so brutal zu mir vor den Augen der Polizei. Bis heute hast du dich nicht bei mir entschuldigt, und bei unserem letzten Telefonat fehlte mir die Kraft, diesen schwarzen Fleck in unserer gemeinsamen Geschichte anzusprechen - und meine Verletzungen, die zu offensichtlichen Narben geworden sind. Du bist älter geworden, Vater. Hitzköpfige Frohnatur, die du immer noch bist, trotzt du deinen siebzig Jahren. Aber auch ich bin älter geworden. Ich bin nicht mehr das kleine Mädchen im Kleidchen mit dem kurzgeschorenem Haar, das die Märchenbücher der „Grünen Reihe“ gierig verschlingt. So viele Ströme sind unter dieser Brücke durch geflossen und heute bin ich dreißig Jahre alt. Dreißig Jahre voller Enttäuschungen, genug, um mir das Kreuz zu brechen. Ich bin nicht mehr das Mädchen, das über weite Felder rennt, das Aprikosen klaut, bei den Nachbarn Sturm klingelt und dann wegrennt. Heute bin ich eine Frau; mit Schwabbelkörper und Hängebusen, nur die Falten sitzen fest. Die Angst verzehrt mich und die Einsamkeit bringt mich um. Niemand klopft an meine Tür und ich vergrabe meinen Kopf im Kissen, damit ich dein Gesicht an der Wand nicht sehen muss. Deine Tochter ist jetzt groß geworden. Du kannst ihre Würde nicht mehr mit Füßen treten, sie nicht mehr schlagen.
Am Tag bevor ich das Dorf verließ, um zum Studieren in die Hauptstadt zu gehen, schimpftest du mit mir und sagtest Dinge, die wollen mir bis heute nicht aus dem Kopf (der im Übrigen bald platzen wird): Du flehtest mich an, mich in Gottes Namen keinen Studentenverbänden anzuschließen. Du batest mich, nur noch ein klein wenig Geduld mit dir zu haben, dann würdest du alles bereitgestellt haben, damit ich ins Ausland gehen und fortan Politik von der anderen Seite des Meeres aus treiben könnte. Doch ich war nicht brav. Ich habe nicht auf dich gehört. Stattdessen bin ich mit meiner Freundin Asmaa von Fakultät zu Fakultät gezogen, habe an sämtlichen öffentlichen Versammlungen des Allgemeinen Tunesischen Studentenverbands teilgenommen und ihn immer unterstützt, bei jeder Aktion. Ich habe über Politik geredet und mit meinen oppositionellen Freundinnen und Freunden in Cafés über Spitzenpolitiker gelästert. Wir wollten eine Revolution, wir wollten tabula rasa, wollten uns öffentlich versammeln, unabhängig, unmaskiert. Die Blogger/innengeneration hat viel gegen die Internetzensur erreicht. Der Mut, die Solidarität und Integrität, die sie angesichts unseres gemeinsamen Feindes an den Tag legten, haben einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. Nie werden wir all die Facebook-Kampagnen vergessen, wie #wegmitammar404, #verpissteuch und #1briefan1politiker[1]. Nie werden wir den Blogger Zouhair Yahyaoui vergessen, den man in Ben Alis Gefängnis zu Tode gefoltert hat. Nie werden wir Lina Ben Mhenni vergessen, die Ikone des Freiheitskampfes, die vor weniger als einem Jahr aus dem Leben geschieden ist.
Warum hast du mich nie bei der Hand genommen, mich nie darin bestärkt, einfach meinen Weg zu gehen und mich vor nichts zu fürchten? Wieso hast du mich nie umarmt? Nicht ein einziges Mal in deinem Leben, Vater?
Ist Tunesien a) eine Republik, b) ein Königreich, c) ein Zoo oder d) ein Gefängnis? So lautete der Titel eines satirischen Beitrags, der auf Zouhair Yahyaouis Blog TUNeZINE als Reaktion auf Ben Alis Verfassungsreferendum erschienen war, mit dem dieser im Jahr 2002 seine Amtszeit verlängert hat. Es ist bitter und es macht wütend, dass man sich zehn Jahre nach der Revolution noch immer dieselbe Frage stellt. Dabei ist die Antwort doch eigentlich klar: Tunesien ist eine Brutstätte der Korrupten, der Speichellecker, der Antidemokraten und Idioten. Tunesien ist ein Großraumgefängnis für Frauen, queere Personen, für Jugendliche mit Träumen, für Kinder, Menschen mit Behinderung und Schwarze. Wir sind Fremde im eigenen Land. Wir gehören nicht dazu. Nichts hier spiegelt uns wider. Nichts erinnert an den Zauber der Anfänge. Als würde alles um uns herum uns sagen: Geht doch ins Ausland. Zehn Jahre nach der Revolution für Freiheit und staatsbürgerliche Würde leben wir immer noch in bitterer Armut. Niedergedrückt von einer allgegenwärtigen Depression, die unsere Seelen zersetzt und uns die Haut versengt, denken wir an Selbstmord. Wir leben in einer gestörten, unsicheren Gesellschaft, die jede und jeden öffentlich verurteilt, die sich nicht auf dem rechten Pfad alles frommen Lebens bewegen. Unsere Richter sind wütend, unsere Parlamentarier sind Selbstmörder und unser Präsident ist ungefähr so zahn-, wie er hilflos ist. Proteste und Streiks gibt es in fast jedem Sektor, dazu eine Wirtschaft, die am Boden ist und eine Politik, die von Gewalt und Feindseligkeit geprägt ist. Wir haben eine Revolution gemacht, um die alten Wächter fortzujagen, doch sie sind zu uns zurückgekehrt, sind in unsere Häuser gedrungen, haben unser Parlament gestürmt. Wir haben eine Revolution gemacht, in der Blut geflossen ist, damit wir in Würde leben können, doch am Ende haben wir nur Verarmung und Marginalisierung geerntet. Wir haben Revolution um der Revolution willen gemacht, und wir werden wieder Revolution um der Revolution willen machen.
Zehn Jahre ist das nun her. Wir haben ein repressives Polizeiregime gestürzt und einen Übergangsweg bestritten, auf dem wir viel erreicht haben, kein Zweifel, aber wir haben auch viele Enttäuschungen erlebt, die unseren Elan ausgebremst haben. Unsere Revolution hat angefangen, zu modern. Schuld daran sind die schlechten ökonomischen und soziokulturellen Bedingungen. Aber unser Herzschlag hält weiter den Takt und eigentlich gibt es noch so Vieles, das unsere Zuwendung und unseren aktiven Widerstand verdienen würde. Die jährlichen Jubiläumsfeiern der Revolution aber sind zu faden Volksfesten verkommen, mit monotonen Reden und abgedroschenen Slogans. So hat die Allgemeine Tunesische Arbeiterunion auch letztes Jahr wieder gemeinsam mit vielen anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen zu einer Großkundgebung am 18. Dezember vor dem Parlament aufgerufen. Es war der zehnte Jahrestag der Tunesischen Revolution, und man wollte ein Zeichen setzen gegen die Gewalt, die heute im Parlament grassiert. Auch „Falgatna“, eine von wütenden Feministinnen der jüngeren Generation gegründete Bewegung, hatte zum Protest aufgerufen: „Unsere Straßen sollen ihre Politik erschüttern!“ Doch als dann der 18. Dezember da war, skandierten die Massen in Le Bardo, dem Vorort von Tunis, ihre Sprechgesänge nicht etwa vor dem Parlament, sondern gute hundert Meter weiter, vor dem Postamt! Als wir das sahen, verschlug es uns die Sprache. Vor allem, als dann auch noch der stellvertretende Generalsekretär der Tunesischen Arbeiterunion Samir Cheffi damit anfing, eine schrecklich monotone, im Kreis eiernde Rede zu halten. Es wollte mir nicht in den Kopf, dass wir es zehn Jahre nach der Revolution nicht hinbekamen, vor dem Parlament zu demonstrieren. Meine Freundin Dschawaher und ich waren außer uns vor Wut und fingen an, mehr oder minder hysterisch zu schreien. Dschawaher hielt eine Tafel hoch, auf die sie mit Kreide geschrieben hatte: „Wieso stehen wir eigentlich vor dem Postamt?“
Ein paar junge Leute gesellten sich zu uns, gemeinsam bildeten wir einen kleinen Chor der Empörten. Dann setzten Dschawaher und ich uns ab. Wir dockten an ein paar Freundinnen an, die weiter hinten bei einer Gruppe junger Männer und Frauen von der antifaschistischen „Falschen Generation“ standen. Wir verschmolzen zu einem einzigen Pulk und schrien: „Keine Podien, keine Reden! Unsere Straße, unsere Wut!“ Dann beschlossen wir im Alleingang auf das Parlament zuzusteuern. Auf halber Strecke ließ die Polizei uns nicht weiter. Wir waren nur eine Handvoll Leute; mit den Hunderten Polizisten, die den Platz umstellt hatten, aneinander zu geraten, war keine Option. Aber klein beigeben wollten wir auch nicht. Wir blieben also stehen und schrien: „Feministische Revolution – Queere Revolution!“, „Arbeit, Freiheit, staatsbürgerliche Würde!“, „Gleichberechtigung und Dezentralisierung, für Frauen und die Provinz!“, „Geknechteter Bürger, nimm dich in Acht! Unterdrückung und Hunger sind an der Macht!“, „A.C.A.B.“, „Gegen Reaktionäre und Besatzer hilft nur Eines und zwar Kampf!“, „Keine Angst, keine Panik, die Straßen gehören uns“, „Das Volk will den Sturz des Regimes!“.
Als ich wieder zu Hause war, steckte mir ein fetter Kloß im Hals. Wir hatten es nicht einmal fertig gebracht vor dem Parlament zu demonstrieren. Traurigkeit drückte mir auf den Schädel wie Blei und ich bekam einen Heulkrampf. Vergeblich suchte ich eine Aspirintablette gegen das Kopfweh. Mein Handy klingelte.
„Hallo, mein Kind. Ich habe die ganze Zeit auf deinen Anruf gewartet. Du hattest doch gesagt, du willst heute Aufnahmen mit mir machen.“
„Entschuldige Papa. Habe ich total vergessen. Ich war auf einer Demo. Und jetzt muss ich glaube ich erstmal mir selbst zuhören.“
Autorin: Rim Benrjeb ist eine tunesische Journalistin und Forscherin im Bereich Politikwissenschaften. Zur Zeit arbeitet sie als Chefredakteurin für jeem.me, einem Onlinemagazin zu Gender und Sexualität und schreibt gelegentlich für Magazine wie ma3azef.com, aljumhuriya.net und andere.
Übersetzung aus dem Arabischen und Kuration: Sandra Hetzl (*1980 in München) übersetzt literarische Texte aus dem Arabischen, u.a. von Rasha Abbas, Mohammad Al Attar, Kadhem Khanjar, Bushra al-Maktari, Aref Hamza, Aboud Saeed, Assaf Alassaf und Raif Badawi, und manchmal schreibt sie auch. Sie hat einen Master in Visual Culture Studies von der Universität der Künste in Berlin, ist Gründerin des Literaturkollektivs 10/11 für zeitgenössische arabische Literatur und des Mini-Literaturfestivals Downtown Spandau Medina.
Dieser Beitrag ist Teil unserer Serie „Blick zurück nach vorn“. Anlässlich von zehn Jahren Revolution in Nordafrika und Westasien schildern die Autor/innen dabei aus verschiedensten Kontexten, was sie hoffen, wovon sie träumen, was sie sich fragen und woran sie zweifeln. In ihren literarischen Essays wird deutlich, wie wichtig die persönlichen Auseinandersetzungen sind, um politische Alternativen zu entwickeln, und was jenseits der großen Ziele erreicht wurde.
Mit dem anhaltenden Kampf gegen autoritäre Regime, für Menschenwürde und politische Reformen beschäftigen wir uns darüber hinaus in multimedialen Projekten: In unserer digitalen scroll-story „Aufgeben hat keine Zukunft“ stellen wir drei Aktivist/innen aus Ägypten, Tunesien und Syrien vor, die zeigen, dass die Revolutionen weitergehen.
[1] Anm. d. Übersetzerin: Ammar 404 ist ein Meme, das die Internetzensur personifiziert, anspielend auf die Fehlermessage error 404, die man bekommt, wenn man eine gesperrte Website aufruft. Eigentlich lautete der Hashtag der bekannten tunesischen Kampagne gegen Internetzensur #nhar3ala3ammar, sprich: #نهارـ على ـ عمار. Auch #verpissteuch (eig.: سيب ـ صلاح#) richtete sich gegen Internetzensur. Bei der Kampagne #1briefan1politiker (eig.: #رسالةـ إلى نائب) wurde dazu aufgerufen, Briefe an Politiker in Form von Facebookposts zu formulieren.